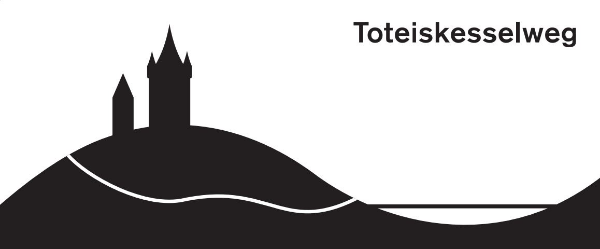1. Datenschutz auf einen Blick
Datenerfassung auf unserer Website
Wer ist verantwortlich für die Datenerfassung auf dieser Website?
Die Datenverarbeitung auf dieser Website erfolgt durch den Websitebetreiber. Dessen Kontaktdaten können Sie dem Impressum dieser Website entnehmen.
Wie erfassen wir Ihre Daten?
Ihre Daten werden zum einen dadurch erhoben, dass Sie uns diese mitteilen. Hierbei kann es sich z.B. um Daten handeln, die Sie in ein Kontaktformular eingeben.
Andere Daten werden automatisch beim Besuch der Website durch unsere IT-Systeme erfasst. Das sind vor allem technische Daten (z.B. Internetbrowser, Betriebssystem oder Uhrzeit des Seitenaufrufs). Die Erfassung dieser Daten erfolgt automatisch, sobald Sie unsere Website betreten.
Wofür nutzen wir Ihre Daten?
Ein Teil der Daten wird erhoben, um eine fehlerfreie Bereitstellung der Website zu gewährleisten. Andere Daten können zur Analyse Ihres Nutzerverhaltens verwendet werden.
Welche Rechte haben Sie bezüglich Ihrer Daten?
Sie haben jederzeit das Recht unentgeltlich Auskunft über Herkunft, Empfänger und Zweck Ihrer gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Sie haben außerdem ein Recht, die Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten zu verlangen. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema Datenschutz können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden. Des Weiteren steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu.
Analyse-Tools und Tools von Drittanbietern
Beim Besuch unserer Website kann Ihr Surf-Verhalten statistisch ausgewertet werden. Das geschieht vor allem mit Cookies und mit sogenannten Analyseprogrammen. Die Analyse Ihres Surf-Verhaltens erfolgt in der Regel anonym; das Surf-Verhalten kann nicht zu Ihnen zurückverfolgt werden. Sie können dieser Analyse widersprechen oder sie durch die Nichtbenutzung bestimmter Tools verhindern. Detaillierte Informationen dazu finden Sie in der folgenden Datenschutzerklärung.
Sie können dieser Analyse widersprechen. Über die Widerspruchsmöglichkeiten werden wir Sie in dieser Datenschutzerklärung informieren.
2. Allgemeine Hinweise und Pflichtinformationen
Datenschutz
Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.
Wenn Sie diese Website benutzen, werden verschiedene personenbezogene Daten erhoben. Personenbezogene Daten sind Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können. Die vorliegende Datenschutzerklärung erläutert, welche Daten wir erheben und wofür wir sie nutzen. Sie erläutert auch, wie und zu welchem Zweck das geschieht.
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.
Hinweis zur verantwortlichen Stelle
Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung auf dieser Website ist:
Agenda 21 – Haager Land e.V.
vertreten durch Heide Schmidt-Schuh
D-83527 Haag
Bund Naturschutz, Ortsgruppe Haag
vertreten durch Heide Schmidt-Schuh
D-83527 Haag
Kontakt:
Bund Naturschutz, Ortsgruppe Haag
Betreuung des Toteiskesselwegs: Judith Harrison
Telefon: 08638/884-2878
E-Mail:
info@toteiskessel.de
Verantwortliche Stelle ist die natürliche oder juristische Person, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten (z.B. Namen, E-Mail-Adressen o. Ä.) entscheidet.
Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung
Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung möglich. Sie können eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.
Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, Daten, die wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder in Erfüllung eines Vertrags automatisiert verarbeiten, an sich oder an einen Dritten in einem gängigen, maschinenlesbaren Format aushändigen zu lassen. Sofern Sie die direkte Übertragung der Daten an einen anderen Verantwortlichen verlangen, erfolgt dies nur, soweit es technisch machbar ist.
Auskunft, Sperrung, Löschung
Sie haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung und ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden.
3. Datenerfassung auf unserer Website
Cookies
Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert.
Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte “Session-Cookies”. Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert bis Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen.
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browser aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein.
Cookies, die zur Durchführung des elektronischen Kommunikationsvorgangs oder zur Bereitstellung bestimmter, von Ihnen erwünschter Funktionen (z.B. Warenkorbfunktion) erforderlich sind, werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO gespeichert. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der Speicherung von Cookies zur technisch fehlerfreien und optimierten Bereitstellung seiner Dienste. Soweit andere Cookies (z.B. Cookies zur Analyse Ihres Surfverhaltens) gespeichert werden, werden diese in dieser Datenschutzerklärung gesondert behandelt.
Server-Log-Dateien
Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten Server-Log-Dateien, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind:
-
-
- Browsertyp und Browserversion
- verwendetes Betriebssystem
- Referrer URL
- Hostname des zugreifenden Rechners
- Uhrzeit der Serveranfrage
- IP-Adresse
Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen.
Grundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der die Verarbeitung von Daten zur Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet.
4. Analyse Tools und Werbung
Google Analytics
Diese Website nutzt Funktionen des Webanalysedienstes Google Analytics. Anbieter ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Google Analytics verwendet so genannte “Cookies”. Das sind Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.
Die Speicherung von Google-Analytics-Cookies erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der Analyse des Nutzerverhaltens, um sowohl sein Webangebot als auch seine Werbung zu optimieren.
IP-Anonymisierung
Wir haben auf dieser Website die Funktion IP-Anonymisierung aktiviert. Dadurch wird Ihre IP-Adresse von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum vor der Übermittlung in die USA gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.
Browser Plugin
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch den Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Widerspruch gegen Datenerfassung
Sie können die Erfassung Ihrer Daten durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf folgenden Link klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, der die Erfassung Ihrer Daten bei zukünftigen Besuchen dieser Website verhindert: [google_analytics_optout]Google Analytics deaktivieren[/google_analytics_optout].
Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten bei Google Analytics finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.
Auftragsdatenverarbeitung
Wir haben mit Google einen Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung abgeschlossen und setzen die strengen Vorgaben der deutschen Datenschutzbehörden bei der Nutzung von Google Analytics vollständig um.
Demografische Merkmale bei Google Analytics
Diese Website nutzt die Funktion “demografische Merkmale” von Google Analytics. Dadurch können Berichte erstellt werden, die Aussagen zu Alter, Geschlecht und Interessen der Seitenbesucher enthalten. Diese Daten stammen aus interessenbezogener Werbung von Google sowie aus Besucherdaten von Drittanbietern. Diese Daten können keiner bestimmten Person zugeordnet werden. Sie können diese Funktion jederzeit über die Anzeigeneinstellungen in Ihrem Google-Konto deaktivieren oder die Erfassung Ihrer Daten durch Google Analytics wie im Punkt “Widerspruch gegen Datenerfassung” dargestellt generell untersagen.
Google Analytics Remarketing
Unsere Websites nutzen die Funktionen von Google Analytics Remarketing in Verbindung mit den geräteübergreifenden Funktionen von Google AdWords und Google DoubleClick. Anbieter ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Diese Funktion ermöglicht es die mit Google Analytics Remarketing erstellten Werbe-Zielgruppen mit den geräteübergreifenden Funktionen von Google AdWords und Google DoubleClick zu verknüpfen. Auf diese Weise können interessenbezogene, personalisierte Werbebotschaften, die in Abhängigkeit Ihres früheren Nutzungs- und Surfverhaltens auf einem Endgerät (z.B. Handy) an Sie angepasst wurden auch auf einem anderen Ihrer Endgeräte (z.B. Tablet oder PC) angezeigt werden.
Haben Sie eine entsprechende Einwilligung erteilt, verknüpft Google zu diesem Zweck Ihren Web- und App-Browserverlauf mit Ihrem Google-Konto. Auf diese Weise können auf jedem Endgerät auf dem Sie sich mit Ihrem Google-Konto anmelden, dieselben personalisierten Werbebotschaften geschaltet werden.
Zur Unterstützung dieser Funktion erfasst Google Analytics google-authentifizierte IDs der Nutzer, die vorübergehend mit unseren Google-Analytics-Daten verknüpft werden, um Zielgruppen für die geräteübergreifende Anzeigenwerbung zu definieren und zu erstellen.
Sie können dem geräteübergreifenden Remarketing/Targeting dauerhaft widersprechen, indem Sie personalisierte Werbung in Ihrem Google-Konto deaktivieren; folgen Sie hierzu diesem Link:
https://www.google.com/settings/ads/onweb/.
Die Zusammenfassung der erfassten Daten in Ihrem Google-Konto erfolgt ausschließlich auf Grundlage Ihrer Einwilligung, die Sie bei Google abgeben oder widerrufen können (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Bei Datenerfassungsvorgängen, die nicht in Ihrem Google-Konto zusammengeführt werden (z.B. weil Sie kein Google-Konto haben oder der Zusammenführung widersprochen haben) beruht die Erfassung der Daten auf Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Das berechtigte Interesse ergibt sich daraus, dass der Websitebetreiber ein Interesse an der anonymisierten Analyse der Websitebesucher zu Werbezwecken hat.
Weitergehende Informationen und die Datenschutzbestimmungen finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google unter:
https://www.google.com/policies/technologies/ads/.
Google reCAPTCHA
Wir nutzen “Google reCAPTCHA” (im Folgenden “reCAPTCHA”) auf unseren Websites. Anbieter ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).
Mit reCAPTCHA soll überprüft werden, ob die Dateneingabe auf unseren Websites (z.B. in einem Kontaktformular) durch einen Menschen oder durch ein automatisiertes Programm erfolgt. Hierzu analysiert reCAPTCHA das Verhalten des Websitebesuchers anhand verschiedener Merkmale. Diese Analyse beginnt automatisch, sobald der Websitebesucher die Website betritt. Zur Analyse wertet reCAPTCHA verschiedene Informationen aus (z.B. IP-Adresse, Verweildauer des Websitebesuchers auf der Website oder vom Nutzer getätigte Mausbewegungen). Die bei der Analyse erfassten Daten werden an Google weitergeleitet.
Die reCAPTCHA-Analysen laufen vollständig im Hintergrund. Websitebesucher werden nicht darauf hingewiesen, dass eine Analyse stattfindet.
Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse daran, seine Webangebote vor missbräuchlicher automatisierter Ausspähung und vor SPAM zu schützen.
Weitere Informationen zu Google reCAPTCHA sowie die Datenschutzerklärung von Google entnehmen Sie folgenden Links:
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ und
https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.
5. Plugins und Tools
Google Maps
Diese Seite nutzt über eine API den Kartendienst Google Maps. Anbieter ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Zur Nutzung der Funktionen von Google Maps ist es notwendig, Ihre IP Adresse zu speichern. Diese Informationen werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Der Anbieter dieser Seite hat keinen Einfluss auf diese Datenübertragung.
Die Nutzung von Google Maps erfolgt im Interesse einer ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote und an einer leichten Auffindbarkeit der von uns auf der Website angegebenen Orte. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar.
Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.